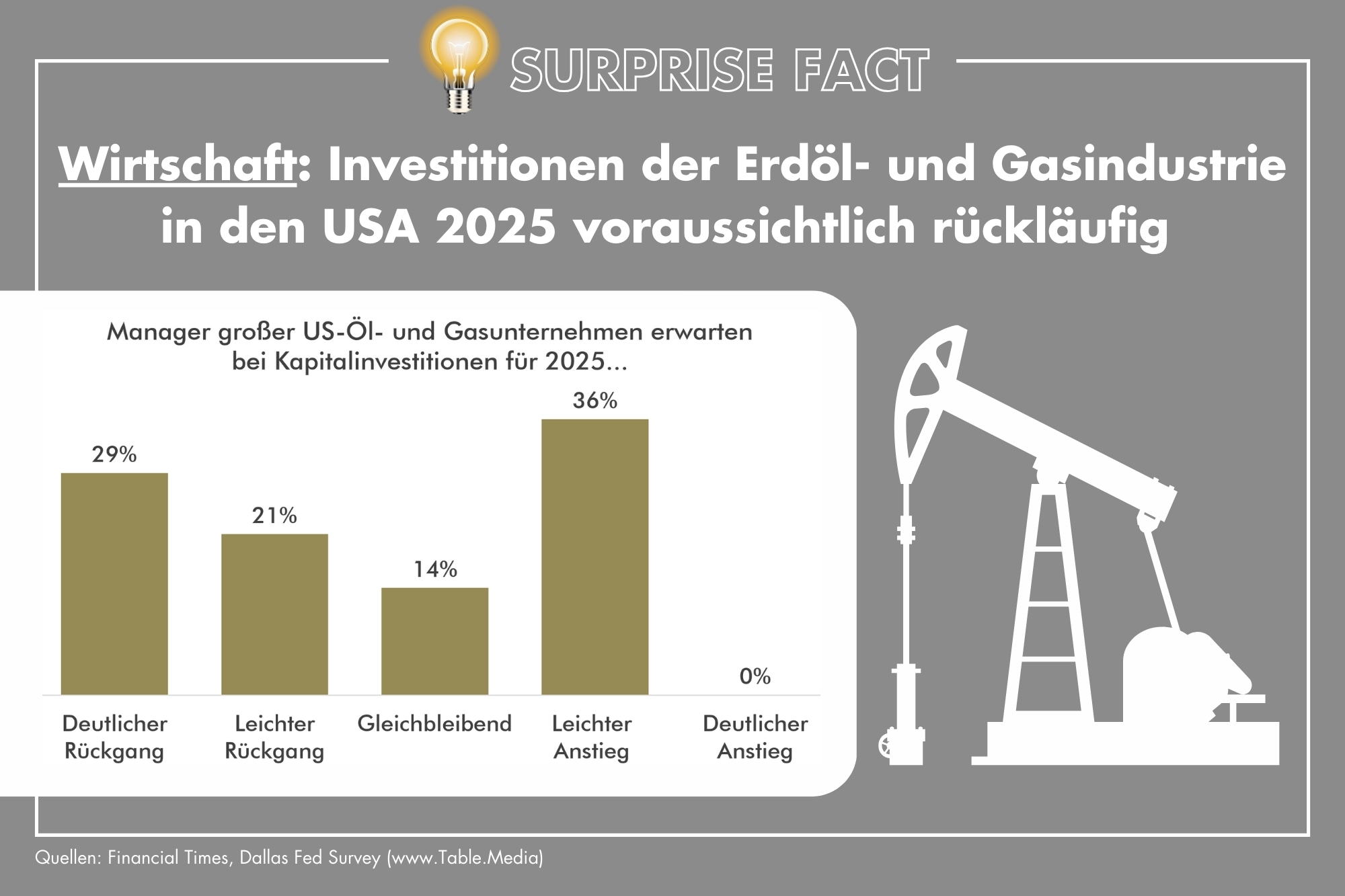„Ziemlich trist. Aspekte des Unglücks” war Thema des „Philosophischen Festes”, einer Kooperation der Festwochen Gmunden und der Internationalen Akademie Traunkirchen. Passend am einst „lacus felix” genannten Traunsee widmeten sich der Philosoph Robert Pfaller, der Journalist und Autor Franz Schuh, der Historiker Philipp Blom und der Quantenphysiker Anton Zeilinger unter der Moderation von Journalistin Renata Schmidtkunz dem Unglück als Zustand menschlichen Verderbens aber auch Bestrebens.
Wie wir mit der Titanic untergehen
„Ein Unglück kommt selten allen” heißt es im Volksmund und so spricht Franz Schuh vom Unglück im Unglück und den vielen kleinen Katastrophen, die 1912 zum Untergang der Titanic führten. Er definiert Unglück als „Mahnmal der Endlichkeit, das immer Zuschauer findet” und fragt mit Bezug auf Susan Sontag (Regarding the Pain of Ohters 2002), wer das kollektive „wir” sein soll, wenn man vom Leid anderer spricht.
Die Kunst, Unglück zu inszenieren
Reinhard Pfaller zieht eine Verbindung zwischen Unglück und Kunst und spricht vom Mimen des Unglücks. Menschen inszenieren ihr Unglück oder das Unglück anderer in besonderer Weise. Unglück wirkt kausal und ist verdient, Glück kommt von außen und wird geschenkt. In dem Sinne ist Unglück eine Fiktion, die wirkliches Unglück hervorbringt. Die vom französischen Philosophen Alain formulierte „Pflicht glücklich zu sein” (original: Propos sur le bonheur 1925) ist folglich die Aufforderung, nicht das eigene Unglück heraufzubeschwören sondern die Willensfreiheit zur Entfaltung des eigenen Glücks zu nützen.
Geschichten machen Glück und Unglück erfahrbar
Um das Geschichtenerzählen geht es Philipp Blom: „Wo das Glück aufhört, da fängt die Sprache an”, kontert er dem von Wittgenstein geprägten Denken, dass die Sprache nicht ausreicht, um über das Glücklichsein zu sprechen. Das Erzählen von Geschichten macht Glück überhaupt erst möglich, meint Blom. So stülpen wir der Realität eine narrative Struktur über, die sie für uns verstehbar macht und deshalb lebensnotwendig ist. Die so strukturierten Geschichten schaffen ganz unterschiedliche Realitäten.
Die Bedeutung von Ereignissen ist nicht linear
Die Verknüpfung von Spieltheorie und Wahrscheinlichkeiten nimmt Anton Zeilinger als Ausgangspunkt um die Frage der Wertigkeiten des Glücks und Unglücks zu beleuchten. Der Einsatz beim Lottoschein ist so gering, dass der Verlust nicht als Unglück empfunden wird, die möglichen Gewinne sind hingegen ungleich höher und damit höherwertig. Am Beispiel des Finanzsystems macht Zeilinger anschaulich, dass die Bedeutung von Ereignissen nicht linear ist. So kann eine Entscheidungsfolge mit Entscheidungen, die — jede für sich genommen — sinnvoll und gut ist, in Kombination eine katastrophale Auswirkung haben.
Die Kultur des edlen Leidenden
Auch kulturell macht man es uns nicht einfach, Glück positiv hinzunehmen, leben wir doch in einer Kultur des leidenden Gottes, in der die Opferrolle identitätsstiftend ist. „Leiden macht edler und würdiger” suggeriert uns das hebräisch geprägte Kulturerbe. Glücklichsein scheint per se suspekt und unverdient. Auch die Existentialphilosophie hat ihren Beitrag zur Schaffung einer problemnarzistischen Nation beigetragen, wo Glücklichsein gar mit einer mangelnden Reflexionsgabe verknüpft wird. Und so ist das Unglück mitunter weniger im Ereignis selbst sondern in dem Ausmaß seiner Geschichten und Inszenierungen.
Glück in der Freiheit und Selbstbestimmung
Ist Glück und Unglück eine persönliche Eigenschaft, eine Version derselben Geschichte, ein kausal bedingtes Zusammenspiel einer Vielzahl unterschiedlicher Parameter? Das Glück finden liegt in dem Streben und der Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung. So sollten wir nicht mehr von der Unterscheidung Opfer versus Täter sprechen, sondern unterscheiden zwischen Opfer sein versus frei sein, meint auch Renata Schmidtkunz: „Wir dürfen nicht in den Hedonismus des Opfers geraten.” Das ist keine leichte Aufgabe, wird es doch als zutiefst moralisch oder modisch anerkannt, Opfer zu sein. Die Aufgabe besteht also darin, echtes Leid zurück in das Soziale zu holen, es anzuerkennen und dafür Sprech- und Schweigemöglichkeiten auch im öffentlichen Raum zu schaffen.