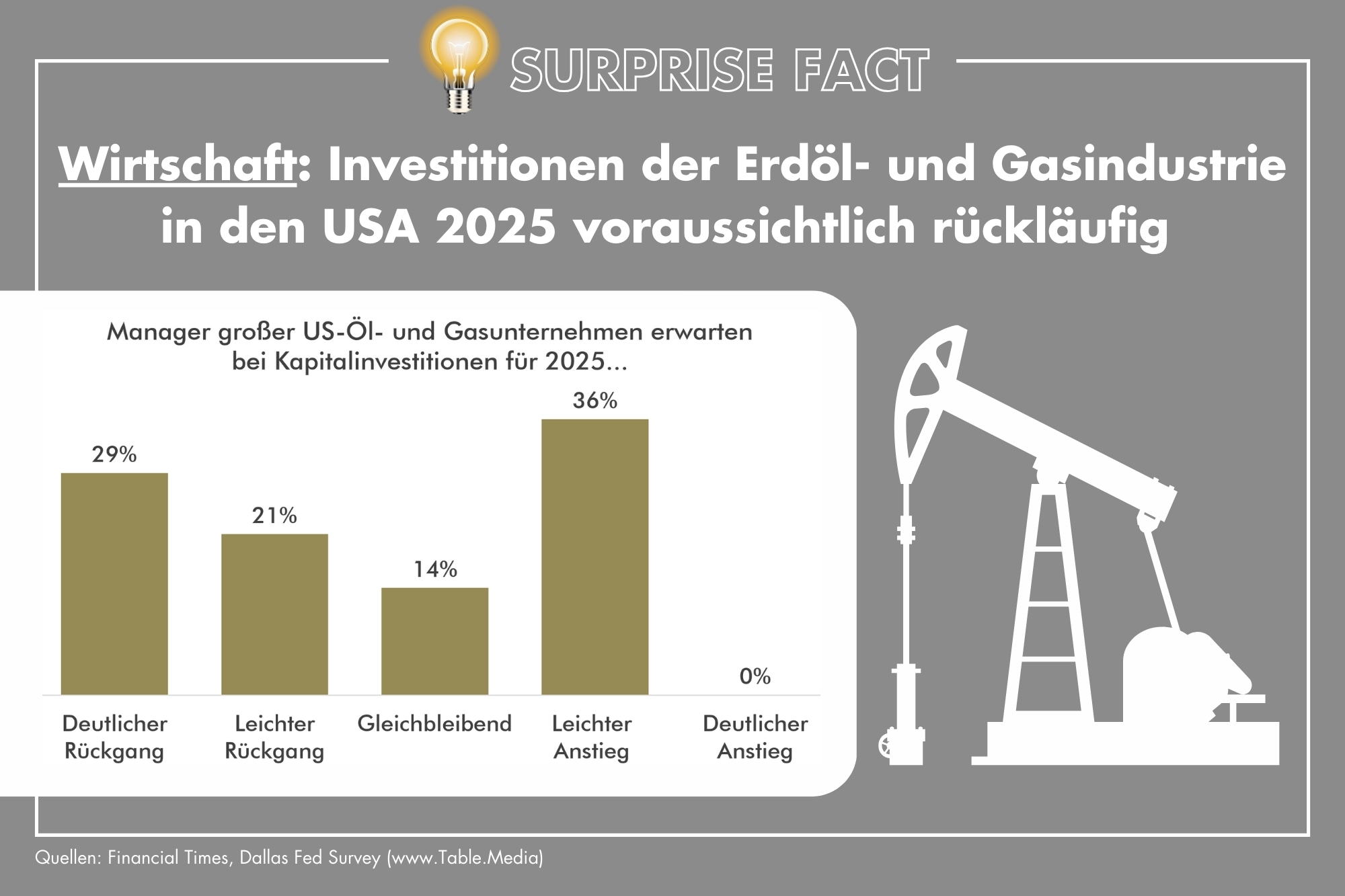Über die Zukunft des Wohlfahrtsstaates nachzudenken und dabei Generationengerechtigkeit kritisch zur Debatte zu stellen, ist grundsätzlich eine gute Sache, meint die Sozialwissenschafterin Beate Großegger, die seit Mitte der 1990er Jahre in der Jugendforschung arbeitet und das Institut für Jugendkulturforschung in Wien leitet, kürzlich auf zukunftmitverantworten.org.
Die mangelnde Bereitschaft, sich der vollen Komplexität des Themas zu stellen, sowie eine auf die Anliegen der eigenen Generation verengte Perspektive stehen einer solidarischen Generationenpolitik aber im Wege.
Generationengerechtigkeit, durch die Brille der Jugend betrachtet
So passiert es, dass man (sogar) in einem Gespräch mit Studierenden zu hören bekommt: „Generationengerechtigkeit sagt mir eigentlich gar nichts – es ist ein altes Wort, ein Wort, das ältere Leute verwenden.“ Fragt man nach, was dieses „alte Wort“ denn bedeute, gibt es durchaus verblüffende Antworten: etwa, dass Jüngere und Ältere miteinander leben und dabei auch gut miteinander auskommen, dass sich Jung und Alt wechselseitig akzeptieren und tolerieren oder dass Jüngere gegenüber älteren Menschen hilfsbereit und höflich sind. Der Fokus liegt hier fernab der großen politischen Bühne auf der Generationenbeziehung, wie sie sich im zwischenmenschlichen Kontakt und nahen persönlichen Umfeld darstellt. Assoziationen zur gesellschaftlichen Generationenordnung und dem auf Tauschgerechtigkeit basierenden Solidarprinzip des Generationenvertrags, in dem staatliche Pensionen nach dem Umlageverfahren geregelt sind und die aktiv Erwerbstätigen durch laufende Versicherungsbeiträge die Pensionen der Älteren finanzieren, drängen sich nicht auf.
Das mag auf den ersten Blick verblüffen, zeigen doch mehrere groß angelegte Jugendstudien in Übereinstimmung, dass junge Menschen in Bezug auf das staatliche Pensionssystem heute durchaus verunsichert sind. Beispielsweise der vom österreichischen Jugendministerium in Auftrag gegebene Jugend-Monitor 5. Zwei von drei Österreichern und Österreicherinnen im Alter von 14 bis 24 Jahren gaben im Rahmen dieser bundesweit durchgeführten Umfrage an, davon auszugehen, dass sie von der Pension, die sie später einmal bekommen, nicht werden leben können. Oder die vierte österreichische Jugend-Wertestudie der zufolge drei Viertel der 14- bis 29-Jährigen glauben, dass ihre Generation später deutlich weniger Pension bekommen werde als die Pensionisten und Pensionistinnen heute, und dass Jugendliche daher früh beginnen müssten, sich um eine zusätzliche private Altersvorsorge zu kümmern. Nur jeder und jede Dritte der im Rahmen der vierten österreichischen Jugend-Wertestudie Befragten war der Meinung, dass das staatliche Pensionssystem trotz allem noch immer sicherer als eine private Altersvorsorge sei. Wobei man nicht verschweigen sollte, dass diese Generation, der die diversen Spekulations‑, Banken- und Finanzmarktskandale der letzten Jahre noch in Erinnerung ist, in privater Pensionsvorsorge freilich auch nicht die Ideallösung sieht.
Aufhorchen lässt, dass sich vor allem junge Menschen aus weniger privilegierten Milieus mit ihren Existenzängsten allein gelassen fühlen. Fernab der bildungsnahen Jugend sagt sich jeder und jede Zweite: „Wir Junge müssen für uns selbst sorgen, uns hilft heute keiner mehr“. Während die Medienberichterstattung mit Schlagzeilen wie „Die Generation Y trägt die Kosten des Sozialstaates“ der allgemeinen Verunsicherung ganz gerne noch etwas nachlegt, bleibt die Politik, so hat man zumindest den Eindruck, Antworten schuldig. Und was machen die jungen Leute, um die es hier geht? Getrieben vom Bemühen um ihr persönliches Fortkommen halten sie sich mit ihren diffusen Zukunftsängsten meist nicht weiter auf. Sie jammern nicht und treten auch nicht mit unangenehmen Fragen an die Öffentlichkeit, sondern verdrängen das Unbehagen, das sie verspüren, so gut sie können.
Warum ist das so? Ganz einfach: Meist fehlen Zeit und Energie, um sich an den großen politischen Fragen abzuarbeiten. Abgesehen davon stellen junge Menschen zahlenmäßig eine vergleichsweise kleine Bevölkerungsgruppe dar und sind daher eine politisch eher marginalisierte Größe. Kritik wie auch Ideen, die von junger Seite kommen, werden in einem von Interessen und Machtpositionen der Älteren bestimmten System allzu oft bereits im Keim erstickt oder zumindest neutralisiert, etwa durch pseudo-dialogorientiertes Schönreden, durch Einsetzen von Arbeitsgruppen, die regelmäßig tagen und doch nichts bewirken, oder auch durch diverse Beteiligungssandkastenspiele. Jugendliche übersetzen diese Erfahrungen dann in ihren Alltag und sagen sich: „Es bringt eh nicht viel, wenn man politisch ist.“
Eine nicht unbedeutende Rolle spielt darüber hinaus aber auch, dass junge Menschen häufig das Gefühl haben, die Älteren verstünden die Probleme der nachrückenden Generation nicht wirklich. Ältere Generationen bewerten die Generationenfrage vor dem Hintergrund sozialstaatlicher Erfahrungen, die ihre eigene Jugend prägten und/oder die ihr bisheriges Leben begleiteten. Dies macht sie für die veränderten Lebensrealitäten, in denen die heutige Jugend aufwächst und die auch ihre Zukunft bestimmen wird, auf einem Auge blind. Zu nennen wären hier etwa neue Krisenszenarien, die seit den späten Nullerjahren die Politik beschäftigen – von der Banken- und Finanzmarkt- bis zur Euro- und Schuldenkrise – , bzw. der gesellschaftliche Diskurs rund um das Ende des Wirtschaftswachstums (Soziologen wie Ulrich Beck sprechen von einem „Fahrstuhleffekt nach unten“ und weisen darauf hin, dass die heutige Jugend in materieller Hinsicht nicht mehr erwarten darf als ihre Elterngeneration, sondern sich vermutlich auf weniger einstellen muss; in der Politik hat sich indessen das Vokabel „Postwachstumsgesellschaft“ etabliert). Veränderte Lebensrealitäten resultieren aber auch aus der mit Migrationsschüben und medialen Prozessen der kulturellen Globalisierung wachsenden Diversität der Lebensverhältnisse. In die Praxis gewendet, heißt das, dass zwar (fast) alle von den gleichen großen Fragen unserer Zeit betroffen sind, dass sich politische Lösungen aber dennoch nicht (mehr) so einfach auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen, sondern sozialmilieu‑, lebenswelt- und auch generationen(lagerung)sensitive Antworten gefragt sind.
Unter Experten und Expertinnen gilt heute als unbestritten, dass die sozialpolitische Umsetzung des Generationenvertrags zukünftig zu einer echten Herausforderung werden könnte. Grund dafür sind der demographische Wandel, der die Belastung der beitragszahlenden erwerbstätigen Bevölkerung angesichts der wachsenden Zahl an Pensionsempfängern stetig erhöht, und ein tiefgreifender Strukturwandel der Arbeitswelt, der dazu führt, dass unbefristete Vollerwerbsarbeitsplätze zunehmend rar werden und sich vor allem Jüngere auf brüchige Berufsbiographien, in denen Erwerbs- und erwerbslose Phasen wechseln, einstellen müssen. Viele junge Menschen haben bereits heute Probleme, unmittelbar nach der Ausbildung in ein angemessen entlohntes, unbefristetes und arbeitsrechtlich geregeltes Erwerbsverhältnis zu finden. Betroffen sind nicht nur Geringqualifizierte, sondern immer öfter auch junge Menschen mit akademischen Abschlüssen. Mangels Perspektiven, aber auch „angefixt“ von gängigen Start-up-Erfolgsmythen versucht sich so mancher von ihnen als „EPU“ und akzeptiert damit, dass fortan gilt: „Pause machen geht nicht, sonst bist du arbeitslos und pleite“. Andere wiederum tendieren dazu, ihre persönlichen Arbeitsmarktchancen durch berufliche Mobilität zu verbessern. Aller Voraussicht nach werden weder die einen, noch die anderen diejenigen sein, die in einigen Jahren, wenn die eigenen Eltern alt geworden sind, den Sozialstaat entlasten werden, indem sie Versorgungs- und Pflegearbeit, so gut wie möglich, selbst leisten. Das sei hier nur nebenbei angemerkt.
Um es auf den Punkt zu bringen: Das Thema „Generationensolidarität“ hat es wirklich in sich. Wie man es auch betrachtet, die Generationenfrage ist eng mit Fragen der Sozialpolitik, aber auch mit Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik verknüpft. Die Herausforderung, mit der wir uns konfrontiert sehen, besteht darin, wohlfahrtsstaatliche Konzepte im Sinne des Ideals der Generationengerechtigkeit an die sich verändernden gesellschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen anzupassen. Schnelle und einfache Antworten kann und wird es nicht geben und dennoch gehört die Debatte geführt, und zwar indem man die Komplexität der Thematik nicht einfach „wegredet“, sondern vielmehr das Bestmögliche tut, um dieser Komplexität gerecht zu werden.
Dazu gehört auch, die Frage zuzulassen, was Generationensolidarität für Menschen an unterschiedlichen sozialen Standorten und in verschiedenen Lebensphasen konkret bedeutet, welche Herausforderungen sie für die eigene wie auch für andere Generationen sehen, was sie unter einer in Generationenfragen sozial gerechten Politik verstehen und ob bzw. in welcher Form sie sich vorstellen könnten, selbst einen Beitrag zu Generationengerechtigkeit zu leisten. Solange nämlich nicht klar ist, welche Konsequenzen Generationengerechtigkeit für uns alle im konkreten persönlichen Alltag hat, wird Generationengerechtigkeit nicht mehr sein als ein sich von Zeit zu Zeit zur schillernden Seifenblase aufblähendes Schlagwort, das – wie vieles andere – politisch konsequenzlos bleibt. In diesem Fall darf man sich dann nicht wundern, wenn jungen Leuten zum Thema „Generationengerechtigkeit” nicht viel mehr einfällt als: „Die Alten haben es schwer, aber wir Junge sind auch ganz schön arm dran …“
Zur Person
Dr. Beate Großegger ist wissenschaftliche Leiterin des Instituts für Jugendkulturforschung. Ihre Arbeitsschwerpunkte umfassen die Felder Soziale Exklusion, Jugend und Arbeitswelt, Jugend und Politik, Jugendkulturen und Lifestyle. Sie ist eine der Expertinnen, die im Rahmen von Zukunft 5.0 ihre Ideen einbringen und die Zukunft mitgestalten.